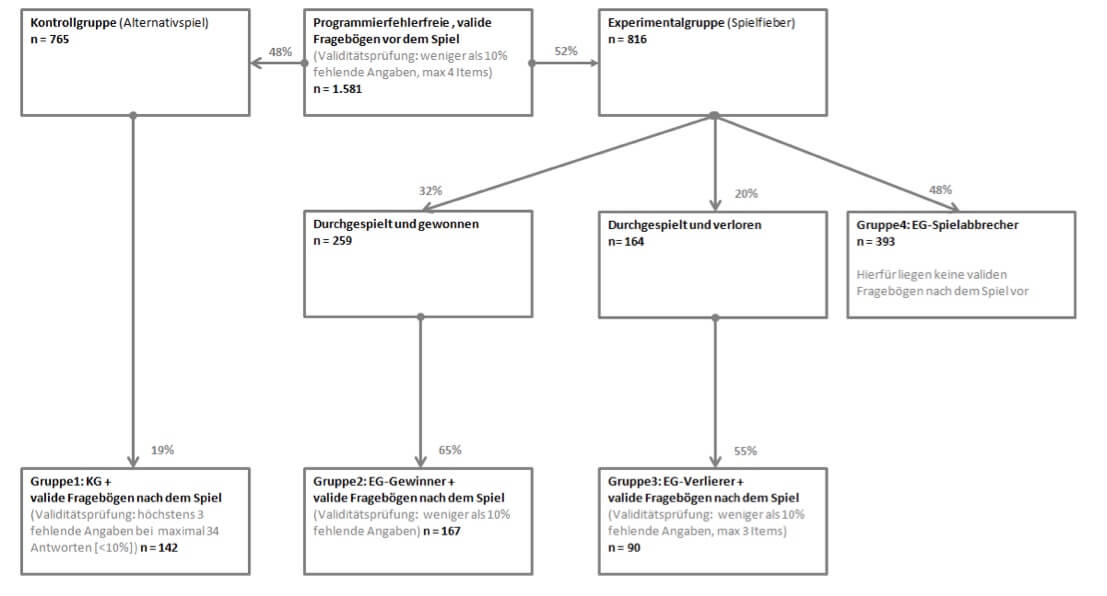Am besten kam „Spielfieber“ bei Haupt- und Realschülern sowie Jugendlichen mit Migrationshintergrund und einer generellen Affinität für Computerspiele an.
Qualitative Auswertungen der verbalen Daten verweisen auf einen nennenswerten Wissenszuwachs in der EG, etwa in Bezug auf (professionelle) Unterstützungsmöglichkeiten beim Vorliegen einer Glücksspielproblematik.
Inferenzstatistische Vergleiche zwischen der KG und EG bestätigen, dass das Interesse am Glücksspiel durch „Spielfieber“ nicht gesteigert wird und somit derartige unerwünschte Nebeneffekte ausbleiben.
Mit der Intervention gehen Positivwirkungen im Hinblick auf die Sensibilisierung für glücksspielbezogene Risiken einher, operationalisiert über die Einschätzung des Gefährdungspotentials verschiedener Spielformen. Dieser Umstand trifft jedoch ebenfalls auf die KG zu, wenngleich weniger stark ausgeprägt.
Die Unterschiede zwischen KG und EG auf der Einstellungsebene sind statistisch bedeutsam: So führte insbesondere das erfolgreiche Durchspielen von „Spielfieber“ zu einer Verringerung von glücksspielbezogenen Fehleinschätzungen. Diese Veränderung bleibt bei den Gewinnern von „Spielfieber“ auch unter Berücksichtigung zahlreicher Störvariablen evident.
Um eine Verringerung von glücksspielbezogenen Fehleinschätzungen in der Population zu erreichen, müssten 8 Jugendliche (für einen kleinen Effekt), 11 Jugendliche (für einen mittleren Effekt) bzw. 30 Jugendliche (für einen großen Effekt) diese Intervention durchlaufen.